
„Unsere westliche Medizin hat ein großes Problem mit Beziehungen. Das kann man gut an der Arzt-Patient-Beziehung sehen, die häufig misslingt und frustrierte und verängstigte Patienten hinterlässt. Eine Änderung würde bedeuten: Ich muss mich wirklich mit Menschen auseinandersetzen, mich ihnen nähern, unbewusste Anteile dabei berücksichtigen. Das will diese Medizin nicht, sie will (unbewusst) weg vom Menschen, weg vom Patienten, weil sie dessen persönliches Drama nicht aushält.”
Christian Schubert
Der Mediziner und Psychologe ist ausgebildeter Psychotherapeut mit Schwerpunkt psychodynamische Psychotherapie. Er war wissenschaftlicher Assistent am Institut für Medizinische Chemie und Biochemie in Innsbruck und baute das Labor für Psychoneuroimmunologie (PNI) an der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie Innsbruck auf. Zudem leitet er die Arbeitsgruppe für Psychoneuroimmunologie des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM). Er ist auch als Autor tätig.
http://www.christian-schubert.at
Für meine Interviewreihe „Mach’s weg“ habe ich Interviews aus verschiedensten Perspektiven über die Corona-Krise, den Graben zwischen “Alternativ-” und Schulmedizin, und über eines der wichtigsten Themen im Leben geführt: Gesundheit. Aber was ist das überhaupt? Lassen sich Krankheiten und ihre Symptome einfach „weg machen“? Wieso kümmern sich Menschen umeinander? Und wie sähe ein Gesundheitssystem aus, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt?
Die gesammelten „Mach’s weg“-Interviews sind hier als Buch zu bestellen.
Das Interview wurde im Oktober 2020 via Zoom geführt
Foto-Credit: Christian Schubert
Laurens Dillmann: Was ist Ihr Beruf?
Christian Schubert: Ich habe Medizin und Psychologie studiert. Ich bin also Arzt und Psychologe. Nach meinen Studien habe ich begonnen, eine Ausbildung zum Labormediziner zu machen. Ich bin in die Forschung gegangen, ins Labor, wo ich an Zellen geforscht habe. Nach drei Jahren habe ich dann die Möglichkeit bekommen, ein Labor für Psychoneuroimmunologie aufzubauen. Da ist alles zusammengekommen. Meine medizinische und psychologische Grundausbildung und meine Laborerfahrung. In der Psychoneuroimmunologie laufen die Fäden zusammen. Außerdem bin ich dann Psychotherapeut geworden und heute klinisch hauptsächlich in diesem Bereich tätig.
In meiner psychoneuroimmunologischen Forschung versuche ich Menschen ganzheitlich, unter Berücksichtigung biologischer, psychologischer und sozialer Daten in ihrer Erkrankungsgeschichte zu verstehen. Ich möchte herausfinden, wie eine Krankheit in die Biographie eines Menschen eingebettet ist. Wann tritt sie auf, und welche Krankheit tritt auf? Ich begreife Krankheit als Ausdruck einer Konfliktgeschichte. Das bedeutet, Krankheiten eben nicht als Ärgernis zu sehen und durch Symptombekämpfung zu beseitigen, sondern sie ganzheitlich zu verstehen und zu behandeln. Dafür braucht es eine Top-down-Herangehensweise. Top-down bedeutet, komplexere Lebensfaktoren wie soziale Beziehungen eines Menschen zu berücksichtigen – die sind es, die uns im besten Fall gesund halten, im Zweifel krank machen.
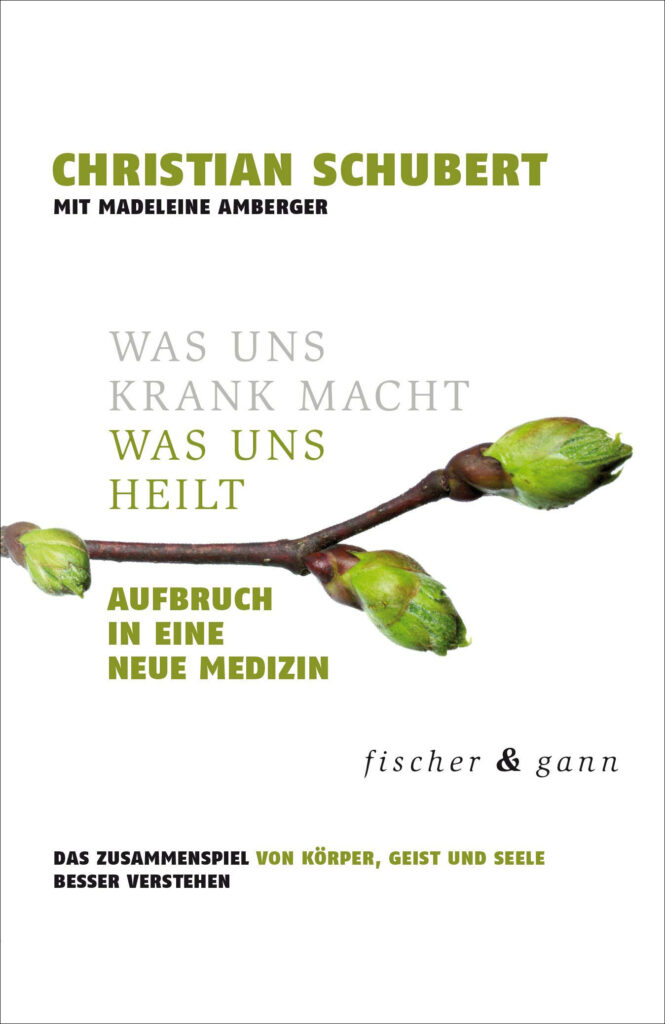
Wieso hat Sie neben der Medizin auch die Psyche des Menschen interessiert?
Woher das kommt? In der Kindheit und Jugend habe ich mich schon dafür interessiert, was in den Menschen so vorgeht. Ich hatte immer Interesse am unsichtbaren Psychischen. (…)
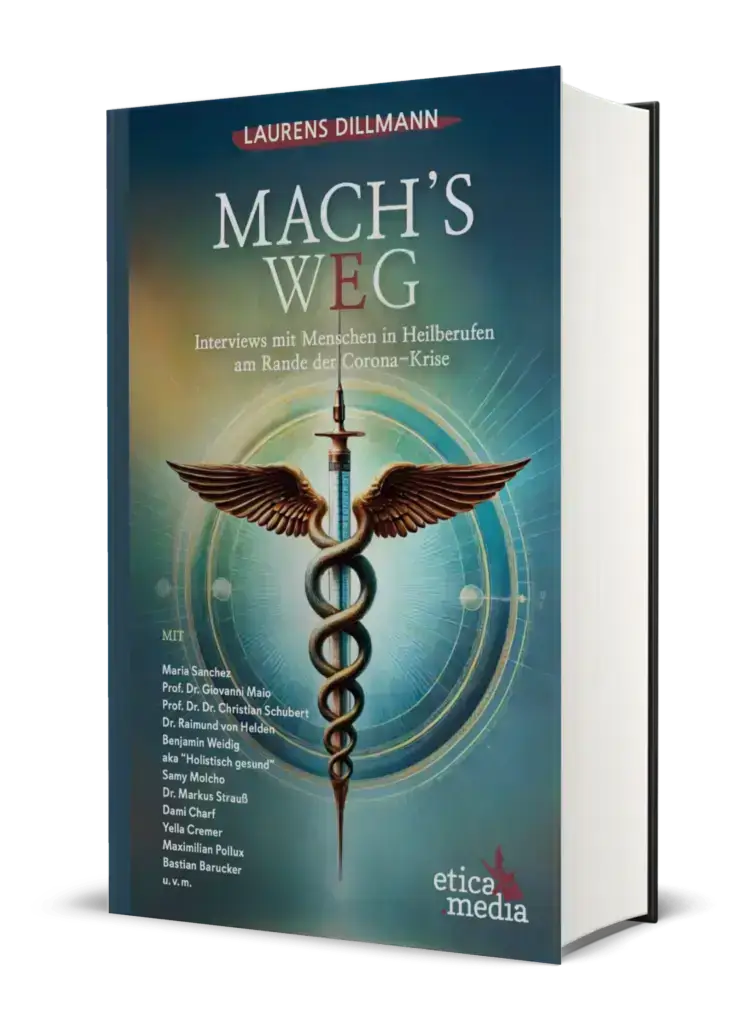
Das ganze Interview gibt es exklusiv im Buch. Hier bestellen.
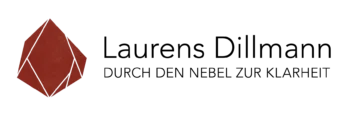
Wow! Was für ein intensives Interview! Danke!
Ein sehr wichtiges Interview! Danke